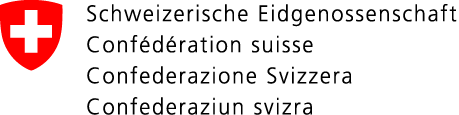Friedrich Dürrenmatt Werkausgabe, Bd. 32: Literatur und Kunst Copyright ©1998 Diogenes Verlag AG Zürich
Meine Zeichnungen sind nicht Nebenarbeiten zu meinen literarischen Werken, sondern die gezeichneten und gemalten Schlachtfelder, auf denen sich meine schriftstellerischen Kämpfe, Abenteuer, Experimente und Niederlagen abspielen. Eine Einsicht, die mir erst beim Durchblättern dieses Buches bewußt geworden ist, auch wenn ich in meiner Jugend nur gezeichnet und erst später geschrieben habe. Ich war immer ein Zeichner. Doch ist die Kreuzigung I meine erste Zeichnung, die ich nachträglich noch zu akzeptieren vermag, aus dem einfachen Grunde, daß ich nicht ein kompositioneller, sondern ein ‚dramaturgischer‘ Zeichner bin. Ich kümmere mich nicht um die Schönheit des Bildes, sondern um dessen Möglichkeit. Um ein Beispiel aus der ‚großen‘ Kunst anzu-führen: Michelangelos ‚David‘ ist eine Abstrusität, ein Koloß, 5,5 m hoch, während Goliath laut Bibel nur 2,9 m groß war. Aber der ‚David‘ ist deshalb eine bedeutende Plastik, weil Michelangelo ihn ‚dramaturgisch‘ in jenem Moment festhält, da er zur ‚Statue‘ wird. Es ist der Augenblick, in dem David Goliath zum erstenmal wahrnimmt und überlegt, wie er ihn besiegen könne: Wo muß ich den Stein hinschleudern? In diesem Moment verharrt der Mensch in der vollkommenen Ruhe des Nachdenkens und des Betrachtens. Er wird dramaturgisch zur Plastik. Ähnliches läßt sich von Michelangelos ‚Moses‘ sagen. Er ist in dem Augenblick dargestellt, da er realisiert, was er doch schon von Jahwe erfahren hat: daß das Volk um das Goldene Kalb tanzt. Noch staunt er, noch bereitet sich der Zorn in ihm erst vor, noch hat er die Gesetzestafeln in der Hand, aber im nächsten Augenblick wird er aufspringen und sie zerschmettern und dann befehlen, dreitausend Männer seines Volkes zu töten: Das ist dramaturgisches Denken in der Plastik.
Dramaturgisch stellte sich daher in meinen Kreuzigungen die Frage: Wie gestalte ich heute eine Kreuzigung? Das Kreuz ist ein Symbol geworden und damit auch als Schmuck verwendbar, etwa als Kreuz zwischen Frauenbrüsten. Der Gedanke, das Kreuz sei einmal ein Marterinstrument gewesen, ist verlorengegangen. In meiner ersten Kreuzigung versuche ich durch den Tanz um das Kreuz, das Kreuz wieder zum Kreuz, zum Gegenstand des Skandals zu machen, den es einmal darstellte. In der zweiten Kreuzigung ist das Kreuz durch ein noch grausameres Marterinstrument, durch das Rad, ersetzt, auch ist nicht ein Mensch, sondern viele Menschen sind gerädert, nur ein Mensch ist gekreuzigt, eine geköpfte schwangere Frau, aus deren aufgeschnittenem Leib ein Kind hängt. An den Blutgerüsten klettern Ratten umher. In der dritten Kreuzigung wird ein dicker gekreuzigter Jude mit abgehackten Armen von Ratten beklettert. Nicht aus ‚Liebe zum Schrecklichen‘ sind diese Blätter entstanden, unzählige Menschen sind auf unvergleichlich schrecklichere Art gestorben als Jesus von Nazareth. Nicht der gekreuzigte Gott sollte unser Skandalot~ sein, sondern der gekreuzigte Mensch; vermag doch der Tod - und sei er noch so fürchterlich - für einen Gott nie so schrecklich wie für einen Menschen zu sein: Der Gott wird wieder auferstehen. So ist denn heute nicht mehr das Kreuz, sondern die Auferstehung das Skandalon des Christentums, und nur so ist das Blatt Auferstehung zu verstehen, entstanden 1978. Es ist nicht ein strahlender Gott, sondern eine Mumie, die ohne Zeugen aufersteht. Hier gibt es eine Parallele zu meinem dramatischen Schaffen: Im ‚Meteor‘ besteht der Skandal darin, daß ein Mensch immer wieder stirbt und immer wieder aufersteht. Er vermag, gerade weil er das Wunder am eigenen Leib erfährt, nicht daran zu glauben.
Anders die Engel: 1952 pumpte ich mir, ein Schriftsteller ohne Geld, in Neuenburg ein Haus zusammen. Es war ziemlich schwierig. Wer wollte auch damals einem Schriftsteller Geld leihen. Die Lebensversicherung ‚Pax‘, in deren Händen die erste Hypothek lag, kündigte mir denn auch gleich. Doch konnten wir das Haus beziehen. Es half, wer helfen konnte. Damals entstanden meine zwei Gouachen Die Astronomen und Ertrunkenes Liebespaar in einer Technik, die ich erst 1978 wieder aufgenommen habe (Die Welt der Atlasse). Ich malte nachts und wurde beim Malen gegen 2 Uhr morgens stets von einer Fledermaus besucht, einem reizenden Tierchen, das ich Mathilde nannte. Einmal war ich unfair, ich schloß das Fenster und machte mich daran, Mathilde zu fangen. Als ich sie gefangen hatte, zeigte ich sie den Kindern und erklärte ihnen, Mathilde sei ein Mäuseengel, dann ließ ich sie wieder frei. Sie war sehr beleidigt und ließ sich nicht mehr blicken. Seitdem ließ mich das Motiv ‚Engel‘ nicht wieder los. Nicht aus Spott, mehr aus Übermut.
Mathildens Rache: Ich zeichnete unzählige Menschenengel, auch eierlegende Cherubim, aus dem Handgelenk, als Karikaturen. Mein Humor verführte mich. Dieser Faktor - mein hauptsächlicher - ist nie zu unterschätzen; er ist überall wirksam. Erst nach und nach kam ich dahinter, daß die Engel doch eigentlich furchterregende Wesen sind, Wesen, zu denen sich Mathilde verhält wie eine Eidechse zum Tyrannosaurus-Rex. Es begann mich dramaturgisch zu interessieren, wie denn heute ein Engel zu gestalten wäre, gibt es doch auch in der Kunst kaum Engel, die mir einleuchten, vielleicht bloß die zustoßenden, zuschlagenden, zornigen Engel in der ‚Apokalypse‘ Dürers. So versuchte ich denn, Engel dramaturgisch darzustellen, die zwei Todesengel und den Engel, an welchem ich lange arbeitete: Auch Engel sind etwas Schreckliches.
Wenn Elisabeth Brock-Sulzer im Zusammenhang mit meinen Federzeichnungen von einer „frühen Schabtechnik Dürrenmatts" schrieb und im späteren Zeichnen - etwa im schnellen Zeichnen nach der Natur mit dem Kugelschreiber - eine „Befreiung" sehen wollte, so kann ich ihr hier nicht beipflichten. Jene Zeichnungen sind nicht dramaturgisch, sondern konventionell. Jeder Maler macht sie besser. Sie waren eine Laune, Fingerübungen meinetwegen, so wie ich einmal einige Wochen lang Collagen verfertigte oder immer wieder karikiere. Die Technik, die ich bei meinen Federzeichnungen ent-wickelte, stellt das zeichnerisch ‚Durchgehende‘ bei mir dar: Hier besitze ich Erfahrung, läßt sich eine Entwicklung nachweisen. Persönlich ziehe ich das Malen vor. Aber Malen reißt mich aus der Arbeit, während meine Federzeichnungen auf meinem Schreibtisch entstehen, natürlich auch die Lavis. So ist die Minotaurus-Serie schnell entstanden - ich arbeitete oft am frühen Morgen daran, nach einer mit Schreiben durchplagten Nacht. Auch das erste Selbstportrait ist um fünf Uhr morgens gepinselt: Ich portraitierte mich in den Rasierspiegel starrend. An einer Federzeichnung dagegen arbeite ich durchschnittlich etwa vierzehn Tage. Viele nehme ich später wieder auf und bearbeite sie neu.
Dramaturgisch und nicht blasphemisch sind auch die Papst-Szenen gemeint: Ist es doch etwas Skandalöses, daß jemand behauptet, er sei der Stellvertreter Christi auf Erden, unfehlbar usw. Ich erinnere mich an eine Fernsehdiskussion über den ‚Stellvertreter‘. Hochhuth wurde von einem Priester angepöbelt, ob er sich denn nicht schäme, mit seinem ‚Stellvertreter‘ Millionen von Gläubigen zu verletzen, denen der Papst etwas Heiliges sei. Man hätte den Priester fragen müssen, ob er sich denn nicht schäme, daß der Papst mit seinem Anspruch jene verletze, die nicht an ihn glauben. Ich glaube nicht an ihn. Das Christentum, das sich nicht als Skandalon begreift, hat keine Berechtigung mehr. Der Papst ist das Sinnbild des Theologischen und damit des Rechthaberischen, des Glaubens, im Besitze der Wahrheit zu sein. Wer diesen Glauben besitzt, streitet. Darum gibt es immer wieder viele Päpste - religiöse und politische -, und darum finden die Streitereien unter ihnen kein Ende: Immer wieder steht Wahrheit gegen Wahrheit, bis der letzte Papst auf dem Mammut seiner Macht in die Eiszeitnacht der Menschheit reitet und in ihr verschwindet (Der letzte Papst).
Zu den Turmbau-Zeichnungen: Dramaturgisch ging es mir darum, die Höhe des Turms darzustellen. Der Turmbau zu Babel wurde oft dargestellt. Ich denke an die Bilder von Bruegel. Aber für mich war der Turm immer zu klein. Es war nie der Turm schlechthin; auf meinen Zeichnungen sieht man deutlich die Erdkrümmung - im Verhältnis zu ihr ist der Turm in der ersten Zeichnung, Turmbau I, 9000 km hoch. Die ‚Wolke‘, die hinuntergreift: kosmischer Staub, der die Erde beleckt. Im Hintergrund die Sonne, wie sie erscheint, wenn wir den Bereich der roten Wasserstofflinien ausblenden. Ich beschäftigte mich seit meiner Kindheit im Dorf mit der Astronomie, später trat die Physik in mein Denken, und heute amüsiert mich vor allem eines ihrer Teilgebiete, die Kosmologie. Hier führt die Moderne die Vorsokratiker weiter. So zeigen denn alle meine Turmbau-Bilder die Unsinnigkeit des Unternehmens auf, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht, und damit die Absurdität menschlichen Unterfangens schlechthin. Der Turm zu Babel ist das Sinnbild der menschlichen Hybris. Er bricht zusammen, und mit ihm stürzt die Menschenwelt zusammen. Was die Menschheit hinterlassen wird, sind ihre Ruinen. Die Turmbau-Zeichnungen IV und V zeigen diesen Zusammenbruch: Gleichzeitig ist das Ende der bewohnten Erde gekommen. Der Stern, der in Turmbau IV explodiert, ist eine Supernova. Zurück bleibt ein weißer Punkt, ein Neutronenstern, ein Stern mit unendlicher Dichte. Sichtbar werden Galaxien in verschiedenen Stadien ihres Werdens und Vergehens und ahnbar riesenhafte ‚schwarze Löcher‘. Sie deuten Endzustände von Sternen an, die wiederum (vielleicht) der Beginn neuer Welten sein können.
Das Motiv des Weltuntergangs ist mit dem Motiv des Todes verbunden: Jeder Mensch, der stirbt, erlebt seinen Weltuntergang. Daß - wie in meinen Stücken - auch in meinen Zeichnungen der Henker eine Rolle spielt, ist nicht verwunderlich; verwunderlich wäre, wenn er fehlen würde. Der Mensch hat in unserem Zeitalter die Rolle des guten alten Sensenmannes übernommen. Der Mensch als Henker ist kein Gevatter Tod mehr, dafür leuchtet mir bisweilen der Gedanke Schopenhauers ein, das Leben des Einzelnen sei mit einer Meereswelle zu vergleichen: Sie vergeht, aber es entstehen neue Wellen. Ich kann mir nicht denken, daß ich einmal ‚nicht mehr‘ bin. Ich kann mir vorstellen, daß ich ‚immer‘ jemand bin. Immer ein anderer. Immer ein neues Bewußtsein, daß auch ich einmal den Weltuntergang erlebe. So ist denn der Weltuntergang von einer immerwährenden Aktualität. Dieses Motiv habe ich auf der Bühne im ‚Portrait eines Planeten‘ gestaltet. Ich konzipierte den Text als Schauspielerübung, um mit einem Minimum an dramaturgischen Mitteln möglichst viel auszusagen. Vor der Niederschrift habe ich das Motiv in einer Mischtechnik dargestellt (Portrait eines Planeten II): Die Photographie eines Mannes mit je einem Kopf in der linken und rechten Hand erschien zur Zeit des Vietnam-Krieges in vielen Illustrierten. Unten links ist eine ausgebrannte Weltraumkapsel, in der zwei amerikanische Astronauten ums Leben kamen. Der Weltmetzger ist eine Gestalt aus der ersten Fassung des Stücks.
So ist denn mein dramaturgisches Denken beim Schreiben, Zeichnen und Malen ein Versuch, immer endgültigere Gestalten zu finden, bildnerische Endformen. So stieß ich über den Weg des Sisyphos-Motivs zum Atlas-Motiv vor. Die erste Sisyphos-Gouache entstand im Jahre 1946, gleichzeitig mit dem Pilatus. Ich verließ die Universität und gab vor, Maler zu werden. Es wäre abenteuerlich gewesen, die Schriftstellerei als mein Ziel anzugeben. Die beiden Bilder malte ich gleichsam als Alibi, um meinen Mitstudenten zu beweisen, daß es mir mit meiner Malerei ernst sei. Gleichzeitig schrieb ich die Erzählung ‚Pilatus‘ und ‚Das Bild des Sisyphos‘. Zum ‚Sisyphos‘ möchte ich nur bemerken, daß mich vor allem die Frage beschäftigte, was Sisyphos zwinge, den Fels immer wieder hochzustemmen. Vielleicht ist es seine Rache, die er an den Göttern nimmt: Er stellt ihre Ungerechtigkeit bloß.
Während mich beim ‚Pilatus‘ die Idee nicht losließ, Pilatus habe vom ersten Augenblick an gewußt, daß ein Gott vor ihm stehe, und sei vom ersten Augenblick an überzeugt gewesen, dieser Gott sei gekommen, ihn zu töten. Atlas dagegen ist eine mythologische Figur, die erst heute wieder darstellbar ist, paradoxerweise; denn ein Mensch, der das Himmelsgewölbe trägt, scheint unserem Weltbild zu widersprechen. Aber wenn wir uns das Anfangsstadium der Welt als ungeheure kompakte Kugel von der Größe der Neptunbahn denken (March) oder als schwarzes Loch, das dann zum Urknall führt; oder wenn als Endstadium einer Welt, in ihrem In-sich-Zusammenstürzen, weil sie zu schwer geworden ist, wiederum die Vision einer Kugel von ungeheurer Schwere vor uns aufsteigt, wird in dieser Weltsicht Atlas mythologisch wieder möglich, gleichzeitig aber auch zum Endbild des Menschen, der die - seine - Welt trägt, tragen muß.
Daß zur selben Zeit wie einige Atlas-Bilder mein letztes Stück entstanden ist, ‚Die Frist‘, ist nicht zufällig, handelt es doch auch von zwei Menschen in der Atlas-Situation: Der erste versucht, die Welt zu tragen, der zweite möchte sie nicht tragen, muß sie aber zum Schluß weiter tragen. Zugegeben, die erste Atlas-Darstellung geht auf das Jahr 1958 zurück, Der versagende Atlas. Das Wichtigste an diesem Weltuntergangsbild sind die Menschen. Sie tragen Inschriften: Atlas muß nicht versagen, Atlas darf nicht versagen, Atlas kann nicht versagen ..., jenen, der schrieb, Atlas wird versagen, hat man geköpft: Die voraussehbare Katastrophe trifft ein, noch schärfer: voraussehbare Katastrophen treffen ein. Daß sich einmal alles rächen wird, drückt die Zeichnung mit dem sonderbaren Titel aus Die gläsernen Särge der Toten werden die Rammböcke sein. Dramaturgisch formuliert: die schlimmstmögliche Wendung trifft ein. Daß ich immer wieder die schlimmstmögliche Wendung darstelle, hat nichts mit Pessimismus zu tun, auch nichts mit einer fixen Idee. Die schlimmstmögliche Wendung ist das dramaturgisch Darstellbare, ist genau das auf der Bühne, was in der Plastik den ‚David‘ zur Statue und meine Bilder zu dramaturgischen Bildern macht.
So etwa auch Die Katastrophe. Das Bild stellt mehr als ein Zugunglück mit anschließender Kettenreaktion dar: Oben stößt gleichzeitig die Sonne mit einem anderen Himmelskörper zusammen. Sechs Minuten später wird die Erde nicht mehr existieren. Auch hier: die schlimmstmögliche Wen-dung, der Versuch, nicht eine, sondern die Katastrophe zu schildern. Nicht das Ding an sich, sondern Bilder an sich sind darstellbar. Die letzte Gestaltung des Atlas-Motivs, Die Welt der Atlasse, gehört zu meinen Lieblingsbildern. Es entstand aus einer Laune heraus. Ich heftete zwei Blätter meines für Gouachen bevorzugten Formats 100 x 71, nebeneinander an die Wand meines Ateliers. Ich wollte eine flüchtige Skizze machen. Das war 1965. Seitdem arbeite ich an diesem Bild. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe zu keinem meiner Bilder je eine Skizze gemacht. Reproduziert ist es im Zustand, den es am 10. Juni 1978 hatte. Zu sehen sind Atlasse, die mit Weltkugeln spielen. Je schwerer eine Welt, desto kleiner ihr Endzustand. Die Atlasse im Vordergrund keuchen unter ihren Kugeln. Daß auch der Eindruck einer Nacht-landung auf dem Flughafen von New York eine Rolle spielt, sei erwähnt, begriff ich doch damals zum erstenmal, wie höllisch es sein muß, auf einer von Menschen überfüllten Erde zu leben.
Zu meinen Portraits: Sie sind schnell entstanden, außer den beiden ersten. Ich bin froh, daß mir von Walter Mehring wenigstens in der Malerei ein Portrait gelang, schriftstellerisch ist es mir bis jetzt nicht gelungen. Dieser sprachgewaltige Lyriker hat in vielen seiner späteren Gedichte nicht sich, sondern uns überlebt. Otto Riggenbach (Portrait eines Psychiaters) ist im Gespräch mit meiner Frau festgehalten. Er ist einer unserer wenigen Neuenburger Freunde und besitzt einige der schönsten Auberjonois. Am spontansten entstand das Portrait meiner Frau, in kaum zehn Minuten, in Ste-Maxime an der Cöte d‘Azur. Wir waren damals besonders glücklich. Wir glaubten, dort unten ein Haus erstanden zu haben, das unseren Vorstellungen entsprach und dessen Kauf später glücklicherweise dann doch scheiterte. In ihrem Übermut bemerkte meine Frau nicht, daß ich sie portraitierte. In Ste-Maxime entstand auch etwas früher die Federzeichnung mit Selbstportrait, St. Tropez 1958: Der Gedanke, daß damals jenseits des Mittelmeeres getötet und gefoltert wurde, bedrückte mich. Leider hat die Zeichnung ihre Aktualität nicht eingebüßt. Den Schauspieler Leonard Steckel malte ich 1965 aus dem Gedächtnis. Das Portrait von Varlin zeichnete ich am 22. Oktober 1977. Es war der letzte Tag, den ich mit Varlin verbrachte. Wir sprachen über Malerei. Varlin sagte mir, er halte Matisse für den größten Maler unserer Zeit. Er sagte: „Das Traurige an der Malerei: Man steht vor einer sauberen Leinwand, nimmt einen Pinsel, und schon ist die Leinwand versaut." Dann hat er mich gezeichnet, mehrmals, wieder durchgestrichen. Eine Zeichnung ließ er gelten und schenkte sie mir, dann sagte er, er wolle schlafen, und ich solle ihn zeichnen. Als er aufwachte, wollte er die Zeichnung sehen. Er fragte mich, ob er wirklich so aussehe. Ich antwortete nichts, und Varlin sagte, dann gehe es nicht mehr lange. Am 30. Oktober ist er gestorben.
Das Portrait eines Hoteliers stellt meinen Freund Hans Liechti dar, Wirt und Bildersammler von Zäziwil, zu Fuß eine dreiviertel Stunde vom Dorfe entfernt, wo ich geboren wurde. Er ist wie ich nach Neuenburg verschlagen worden. Ich sitze nach dem Schreiben oft bis tief in die Nacht bei ihm, erzähle ihm, was ich schreibe, und zeichne, was man zeichnen könnte. Ich weiß nicht, ob ich ohne ihn noch zeichnen und malen würde. Seine Begeisterung für die Malerei wirkt produktiv. Sein Portrait entstand an einem Sonntag nachmittag. Er hatte gekocht, seine Beiz war zu Mittag überfüllt gewesen, dazu waren Verwandte gekommen, und am Abend hatte er im oberen Saal ein Bankett. Er kam im Arbeitsgewand in mein Atelier, um sich auszuruhen. Nach nicht ganz einer Stunde verließ er mich, um sich wieder hinter seinen Herd zu stellen, und ich malte das Bild zu Ende. Um zehn Uhr abends rief ich ihn an, er solle kommen. Er kam, immer noch im Arbeitsgewand, und war mit mir zufrieden.
Meine letzten Federzeichnungen sind ebenfalls Portraits: Der zornige Gott - wer begreift seinen Zorn nicht? (vollendet habe ich die Federzeichnung bei Liechti mit einem Küchenmesser). Mazdak war der Gründer einer kommunistischen Sekte. Ungefähr 530. n. Chr. wurden 3000 seiner Anhänger vom persischen Groß-könig kopfvoran in die Erde gepfählt - und damit ihre Idee in den Boden gepflanzt. Man kann einen Menschen töten, aber die Idee lebt weiter. Das Kind, das die aussätzige und wahnsinnige Ophelia zur Welt bringt, wird weder aussätzig noch wahnsinnig sein. Geier entmannen den aufs Pferd gebundenen Kosaken Mazeppa. Er lebt in Gedichten weiter. Chronos, Uranus entmannend: Nur so war es möglich, daß die Zeit ihre Herrschaft begann; die mythologische Darstellung des Urknalls.
Mit den Labyrinthen nehme ich ein Motiv auf, das mich auch schriftstellerisch fasziniert. Ich behandelte es zuerst in der Novelle ‚Die Stadt‘ und behandle es jetzt in der Erzählung ‚Der Winterkrieg in Tibet‘. Zum Labyrinth gehört der Minotaurus. Dieser ist eine Ungestalt, als solche ist er das Bild des Einzelnen, des Vereinzelten. Der Einzelne steht einer Welt gegenüber, die für ihn undurchschaubar ist: Das Labyrinth ist die Welt vom Minotaurus aus gesehen. Die Minotaurus-Blätter zeigen denn auch den Minotaurus ohne die Erfahrung des Andern, des Du. Er versteht nur zu vergewaltigen und zu töten. Er stirbt nicht durch Theseus, er verendet wie ein Stück Vieh. Theseus ist nicht imstande, ihn aufzuspüren. Die Ermordung des Minotaurus ist eine Legende. Aus der Gestalt des Minotaurus ist als Assoziation Der Weltstier entstanden, in einer etwas anderen Technik, weil das Papier keine andere erlaubte. Der Weltstier ist das Sinnbild des amoklaufenden Ungeheuers, das wir Weltgeschichte‘ nennen. Das Blatt Die beiden Tiere stellt eine Paraphrase zum Manichäismus dar, der heute ja wieder aufgekommen ist, zum Glauben, die Weltgeschichte sei ein Kampf zwischen zwei Prinzipien, einem guten und einem bösen. Die beiden Saurier, die sich im Hintergrund ineinander verbissen haben, sind beide gleich stur.
Natürlich gibt es auch nichtdramaturgische Blätter, Assoziationen zu literarischen Motiven, wie etwa Flucht I und Flucht II, die ich einst im ‚Tunnel‘ oder in der ‚Falle‘ gestaltet habe. Der Kampf der beiden Alten zeigt, daß der Haß auch dann weiterwütet, wenn er seine Motivation verloren hat. Ich lernte nie zeichnen oder malen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie man Ölbilder malt. Der einzige Mensch, den ich fragte: „Wie malt man eigentlich Öl?", war Anna Keel. Und sie sagte mir: „Nimm Petrol." Die Ölbilder malte ich alle 1966. Daß auch meine Bank-Bilder mit Öl und Petrol gemalt sind, stellt keine Kritik am schweizerischen Bankwesen dar. Im Gegenteil, daß ich es würdig enden lasse (Letzte Generalversammlung der Eidgenössischen Bankanstalt), sollte meine Kreditwürdigkeit bei unseren Banken erhöhen, wie ich hoffe, besonders jetzt, wo ich sie nötiger habe denn je, existiere ich doch - wie ich eben im ‚Brückenbauer‘ lese - für die Kritik literarisch nicht mehr. Doch kehrte ich seitdem wieder zu den Wasserfarben zurück. Gerade meine Bank-Bilder machen deutlich, daß die Gründe meiner Zeichnungen und Malereien nicht nur in dramaturgischen Überlegungen liegen; meine Bank-Bilder sind der Nachhall meiner Komödie ‚Frank V.‘, der Oper einer Privatbank. Ein Theaterstück, dessen bühnenmäßige Realisierung eigentlich nie glückte. Eine Neufassung liegt in meinem Schreibtisch. Aber auch Der Turm zu Babel oder die Blätter Der gefangene Narses und Byzantinische Heilige mit den byzantinischen Motiven gehen auf ein vernichtetes Werk oder auf ein Fragment zurück. Zeichnen als Ersatzhandlung.
Doch gibt es natürlich noch andere Zusammenhänge zwischen meinem literarischen und meinem zeichnerischen Schaffen. Jedes Darstellen, in welchen Medien auch immer, setzt einen Hintergrund voraus, der aus Eindrücken, Bildern und Denken besteht. Dieser Hintergrund ist heute nicht mehr allgemein; es sei denn, man gebe sich links engagiert, katholisch oder sei beides zusammen usw. Der heutige Schriftsteller, aber auch der heutige Maler, sucht im allgemeinen unbewußt eine Ideologie, etwas Allgemeines. Ich lehnte es seit jeher ab, mich auf einen allgemeinen Nenner bringen zu lassen. Ich bin deshalb notwendigerweise nur wenigen verständlich. Auf die Voraussetzungen meines literarischen Schaffens, aber auch meiner Bilder, die in meinem Denken liegen, das im wesentlichen erkenntnistheoretisch ist, und in meinem Humor, der an sich subjektiv ist, kommt man nicht von selber. Darum nimmt man mich lieber nicht ernst, sonst müßte man mitdenken. Ich bin bewußt ein Einzelgänger. Ich gehöre nicht zur Avantgarde. Wer heute dieser angehört, trampelt in einer Herde mit.
So sind denn auch die Assoziationen, aus denen sich meine Bilder zusammenbauen, Resultate meines persönlichen Denkabenteuers, nicht die einer allgemeinen Denkmethode. Ich male nicht surrealistische Bilder - der Surrealismus ist eine Ideologie -, ich male für mich verständliche Bilder: Ich male für mich. Darum bin ich kein Maler. Ich stelle mich der Zeit, und unserer Zeit kommt man nicht mit dem Wort allein bei. Das Denken in Begriffen, die Methoden der Mathematik, die notwendige Abstraktheit des wissenschaftlichen Denkens sind in der bildenden Kunst abstrakt nicht darstellbar. Es gibt nichts Abstrakteres als die Formel. Sie ist die letztmögliche Abstraktion. E=mc2. zum Beispiel. Die Mathematik hat eine Abstraktionsfähigkeit, die nicht mehr anschaulich ist, die das Anschauliche notwendigerweise durchstößt. Es ist unmöglich, die Relativitätstheorie nicht abstrakt darzustellen, außer man stellt sie in sinnlichen Gleichnissen dar. Sinnliche Gleichnisse jedoch sind nicht geometrische oder stereometrische Formen, sondern Mythen: unsere Mythen. Der ermöglichte Atlas.
Vielleicht sind meine ersten Zeichnungen von Bosch beeinflußt, die grotesken Bilder des Beginns (Apokalyptische Reiter, Die Welt als Theater), noch bevor ich Schriftsteller wurde. Aber ich suche nicht die Symbolik, die Bosch fand. Was ich - in meinem Schreiben wie Zeichnen - suche, sind die Bilder und Gleichnisse, die im Zeitalter der Wissenschaft noch möglich sind, einem Zeitalter, dem etwas gelang, was der Philosophie mißlang: die Realität abstrakt zu beschreiben. Wenn wir vier oder n Dimensionen brauchen, benötigen wir sie, weil sich die Fakten der Realität nicht anders beschreiben lassen. Wir haben nicht die Möglichkeit, diese hochkomplizierten Zusammenhänge und Gegebenheiten zu vereinfachen. Die Kernphysik ist nicht volkstümlich darstellbar. Sie ist nur volkstümlich zu umschreiben. Sie muß gedacht werden, will sie erfaßt werden. Es gibt keinen Rückzug ins Einfache. Was seiner Natur nach nicht anschaulich ist, kann lediglich durch Gleichnisse dargestellt werden. Darum ist die abstrakte Kunst - dort, wo sie stimmt - bestenfalls poetisch, Schönheit der Linien. Sie ist reine Form und damit reine Ästhetik. Nie war die Malerei ästhetischer denn heute. Was sie als ihren Sinn ausgibt, ist nur behauptet, nicht integriert. Sie als ‚intellektuelle Aussage‘ darzustellen ist Unsinn.
Immer wieder: ich bin kein Maler. Ich male technisch wie ein Kind, aber ich denke nicht wie ein Kind. Ich male aus dem gleichen Grund, wie ich schreibe: weil ich denke. Malerei als eine Kunst, ‚schöne Bilder‘ zu machen, interessiert mich nicht, ebenso wie mich die Kunst, ‚schönes Theater‘ zu machen, nicht interessiert. Ich könnte nicht hauptberuflich Maler sein, aus dem einfachen Grunde: ich wüßte die meiste Zeit nicht, was ich malen sollte. Ich bin ein zeichnerischer Dilettant. Als Student wohnte ich in Bern in einem Zimmer, das ich ausgemalt hatte. Über dem Bett war eine skurrile Kreuzigung, daneben Szenen aus meinem ersten, nie veröffentlichten Stück, zu dem noch eine Zeichnung existiert, eine meiner frühesten. So stellt denn mein Malen und Zeichnen eine Ergänzung meiner Schriftstellerei dar - für alles, das ich nur bildnerisch ausdrücken kann. So gibt es denn auch nur wenig rein ‚Illustratives‘ von mir. Auch beim Schreiben gehe ich nicht von einem Problem aus, sondern von Bildern, denn das Ursprüngliche ist stets das Bild, die Situation - die Welt. Im übrigen bin ich immer noch erstaunt über die Verrücktheit Daniel Keels, dieses Buch herauszubringen, und immer noch verlegen, daß Manuel Gasser, dem die Malerei so viel verdankt, gar das Vorwort dazu schrieb, und ich muß es zugeben - nun doch etwas stolz darüber, daß er über meine Malerei und Zeichnerei kein ‚Donnerwort‘ gesprochen hat.
Weitere Informationen
Friedrich Dürrenmatt «Persönliche Anmerkung zu meinen Bildern und Zeichnungen» (1978) (PDF, 46 kB, 28.03.2009)Friedrich Dürrenmatt Werkausgabe, Bd. 32: Literatur und Kunst. Copyright ©1998 Diogenes Verlag AG Zürich